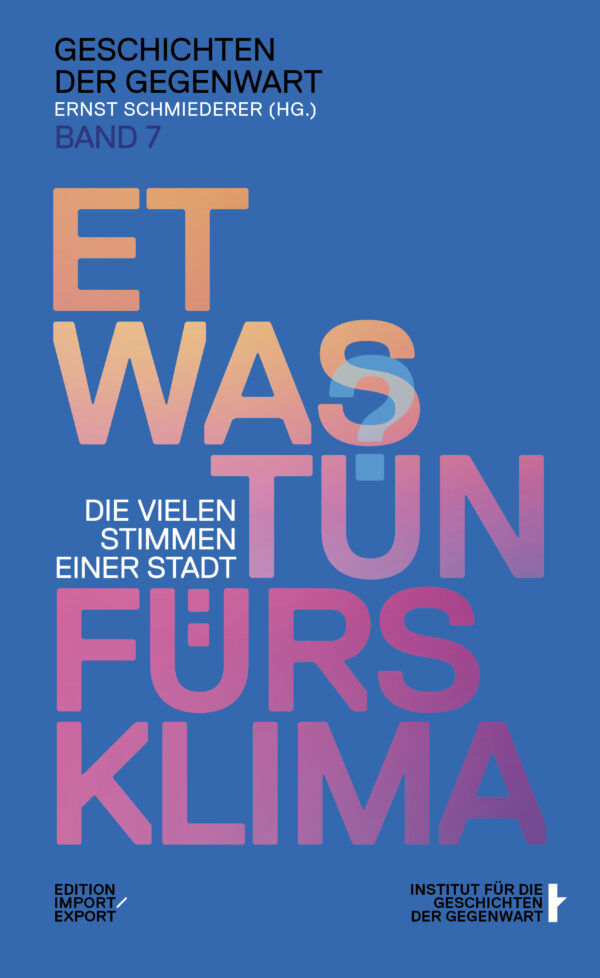Ein Experiment in narrativerDemokratie
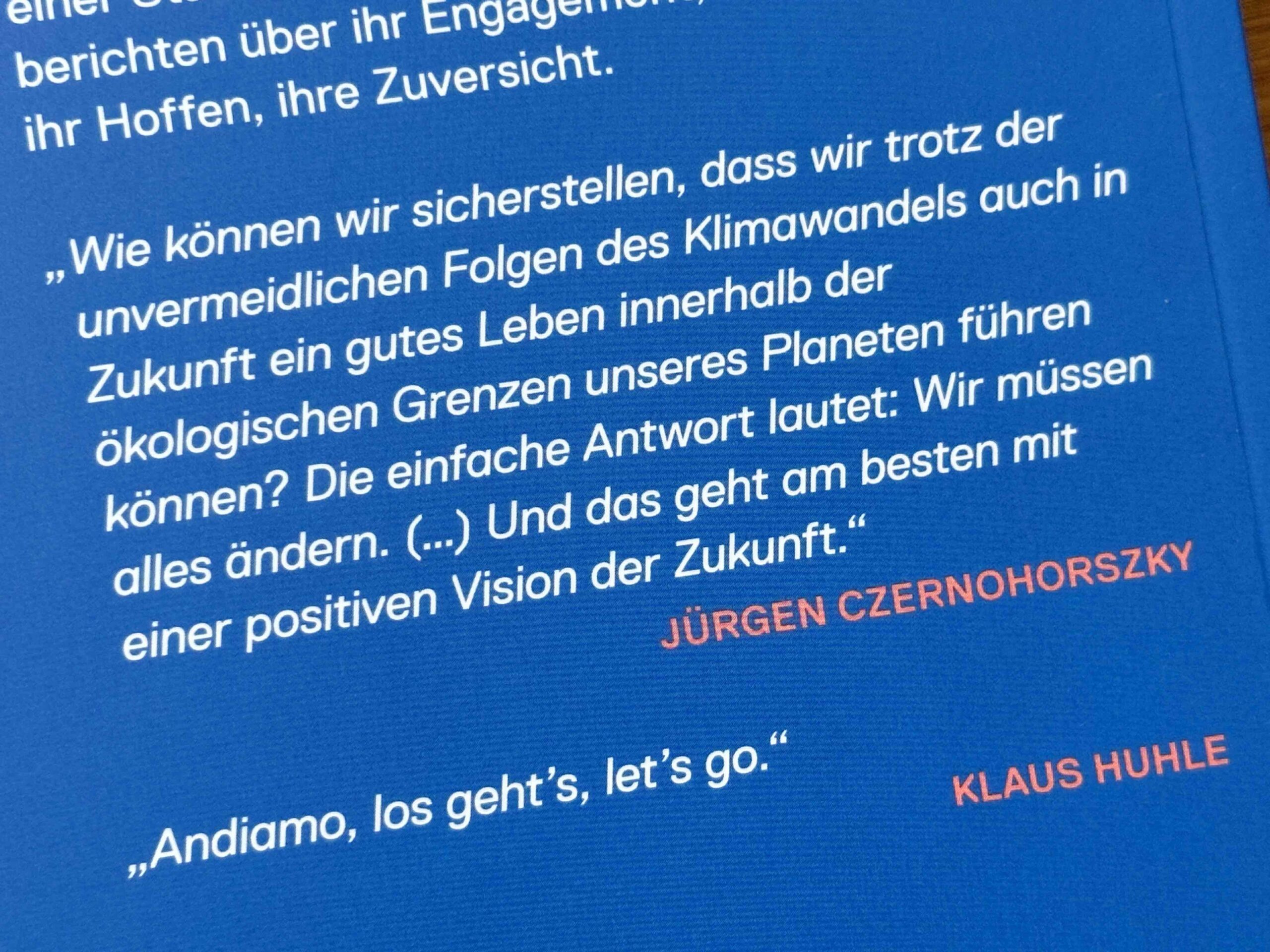
Wie geht es Ihnen? Was denken Sie? Wie blicken Sie auf die Gegenwart? Wie reagieren Sie auf den Klimanotstand? Sind Sie verzweifelt? Haben Sie Hoffnung? Solchen Fragen wollen wir mit diesem Projekt auf den Grund gehen. Wie tickt Wien? Wie reagieren Menschen in dieser Stadt auf die Klimakrise? Jene, die hier zur Welt gekommen und aufgewachsen sind, und jene, die zum Leben und Arbeiten hierhergekommen sind?
Was macht der permanente Nachrichtenstrom mit ihnen? Was denken sie angesichts von Extremwetterereignissen, Meeresspiegelanstieg und Bodenversiegelung? Welche Spuren hinterlässt das Wissen um Luftverschmutzung und Entwaldung, um das Absterben der Korallenriffe und das Auftauen der Permafrostböden in unseren Köpfen?
Wo Demokratie auf Repräsentation baut, tun sich zwangsläufig Leerstellen auf. In solchen Repräsentationslücken gedeihen Gefühle von Entfremdung und Misstrauen besonders gut. Dieser Behauptung liegt eine einfache Rechnung zugrunde: Je kleinflächiger die Überschneidungen werden zwischen den Lebenswelten der Repräsentant:innen und denen, die sie repräsentieren sollten, desto größer das diesbezügliche Risiko. Das vorliegende Projekt ist ein Versuch, solche Repräsentationslücken zu erkennen und sie produktiv zu füllen. Also etwa Menschen zu bitten, ihre Sicht der Dinge aufzuschreiben, zu erzählen, in den Diskurs einzubringen.
Seit rund 15 Jahren haben wir im Rahmen unseres Blinklicht Media Labs einiges Know-how in der Entwicklung und Umsetzung von Beteiligungsprojekten (Stichwort: der von Pierre Rosanvallon geprägte Begriff „narrative Demokratie“ IN: Pierre Rosanvallon: Das Parlament der Unsichtbaren. Edition IMPORT/EXPORT, Wien 2015 ) erworben. Dokumentiert ist dies u. a. in einer Reihe von Büchern („Geschichten der Gegenwart“). Darauf aufbauend haben wir „in Wien lebende oder mit der Stadt verbundene Menschen eingeladen, ihre persönlichen Geschichten, ihre Visionen, ihre Ideen, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen, ihre Forderungen im Kontext der Klimakrise zu formulie-ren“ – mit dem Versprechen, diese Texte in einem Buch zu veröffentlichen, um sie in Diskussionen, Vorträgen, Workshops möglichst breit wirksam machen zu können. Als Referenz wurde bei den Einladungen jeweils auf die Geschichte von Eduard Suess und der I. Wiener Hochquellenleitung verwiesen.
ETWAS TUN FÜRS KLIMA. Die vielen Stimmen einer Stadt.
Die Hitzerekorde fallen im Monatsrhythmus. Die Gletscher schmelzen immer schneller. Stark- regenereignisse und Trockenperioden nehmen zu. Längst sind die Bedrohungen der Klimakrise mit Händen zu greifen. Verleugnen? Geht nicht mehr. Verzweifeln? Bringt nichts. Was bleibt? Etwas tun! Genau davon erzählen „Die vielen Stimmen einer Stadt“: Menschen in und aus Wien berichten über ihr Engagement, ihre […]
Idealiter hätten wir natürlich alle in der Stadt lebenden Menschen einladen und um ihre Texte bitten müssen die Klimakrise betrifft schließlich jede und jeden. Diesfalls aber mussten wir uns aus vielerlei Gründen nach der Decke strecken, also das umsetzen, was in unserer Reichweite lag. In einer ersten Phase haben rund 100 Schülerinnen und Schüler der BHAK/BHAS Wien 22 im Rahmen von Schreibworkshops Textskizzen zum Themenkomplex Wasser – Abwasser – Kanal – Klima beigesteuert. Darauf bauend wurden in der zweiten Phase individuell Erwachsene eingeladen, ausführlicher und möglichst mit Verweis auf ihren jeweiligen biografischen Hintergrund Texte im Umfang von etwa 10.000 Zeichen zu verfassen. Und zwar auf Basis folgender Einleitung:
„Klimakrise – was tun? Der amerikanische Humangeograf Anthony Leiserowitz hat einst versucht, der Welt den Klimawandel in fünf Sätzen zu erklären: ‚It’s real. It’s us. Experts agree. It’s bad. There’s hope.‘ Längst schon sprechen wir nicht mehr vom ‑wandel, sondern von der Klimakrise. Die fünf Sätze aber haben Bestand: Ja, die Klimakrise ist real. Der Mensch ist verantwortlich. Die Experten sind sich einig. Die Lage ist schlimm. Und es gibt Hoffnung: wir können etwas tun! Aber was?“ Genau davon handeln die in diesem Band versammelten Texte. Zwei Dutzend Autorinnen und Autoren, die unserer Bitte um einen Textbeitrag gefolgt sind, konfrontieren uns mit ihrem jeweils sehr individuellen Blick auf die Klimakrise. Sie erzählen von ihrem Engagement, von ihrem Hoffen, ihrer Trauer, ihrer Zuversicht. Als Fundament darunter gelegt wurden drei Selektionen mit Textauszügen aus der in den Workshops entstandenen Materialfülle: Jugendliche reflektieren über die Themen Wasser, Kanal und Klimakrise, um im Anschluss Antworten auf die Kernfrage zu formulieren: Was tun?
„Allgemein kann jeder mithelfen“, schreibt etwa die 15-jährige Kerstin. Oder, in den Worten der Cellistin Stefanie Waegner: „Der Kern, das individuelle, unverwechselbare Mindset, die persönliche Note, das ‚Fantastische‘, das Großzügige – sie sind Schlüssel für positive Veränderungen, inspirierend, ermutigend.“ Dies ergänzend formuliert der Organisationsberater Claus Faber: „Selbstwirksamkeit ist kein individueller, sondern ein sozialer Prozess im Kontakt.“ Eine Überlegung, die ihn schließlich zur Gründung des Netzwerks #coaches-forfuture bewegte, welches die Klimabewegung ehrenamtlich berät.
Solche Verbindungen aufzuzeigen, Brücken zu schlagen von einem Individuum zum anderen, von einem Gedanken zum nächsten, von einer Idee zur Tat – das war eine der Zielvorgaben, die beim Entstehen des Buches im Blick bleiben sollte. Der Auseinandersetzung mit der Klimakrise, dem Kampf gegen die Ausbeutung und Zerstörung der Natur liegt schließlich immer auch der Gedanke an den Menschen zugrunde. Nicht einfach abstrakt die Erde, sondern das Überleben der Menschheit steht im Zentrum des Nachdenkens: Wie können wir gute Lebensbedingungen für alle Menschen, also auch für die uns nachfolgenden, realisieren? Wasser, Kanalisation, Hygiene sind in diesem Kontext nicht nur essenzielle Faktoren für unser Leben; sie lassen sich handlungsleitend auch als unmittelbar wirksame Stellschrauben denken: etwas tun!