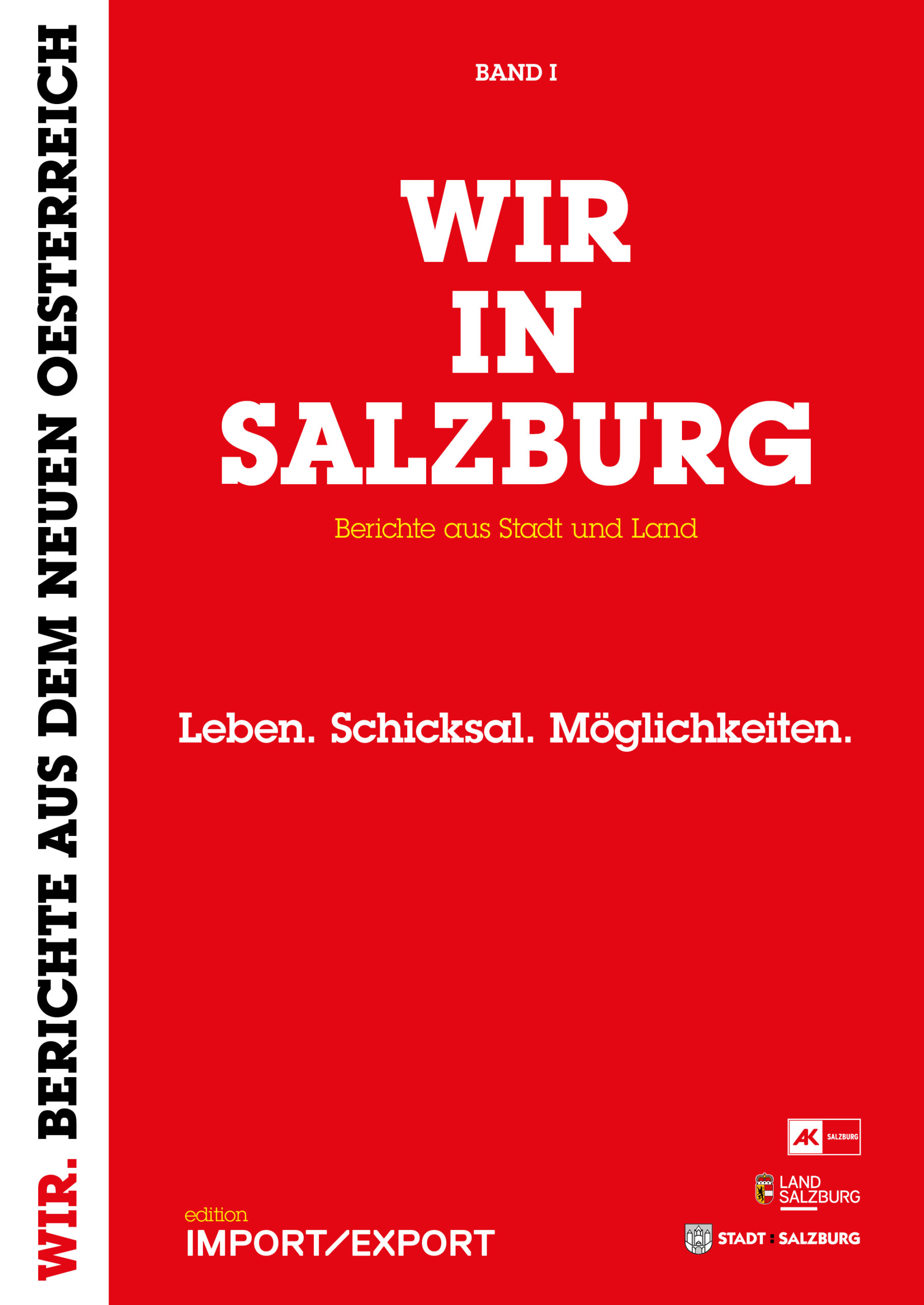376 junge Autorinnen und Autoren erzählen in diesen zwei Salzburg-Bänden, wie sie geworden sind, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute leben, lernen, lieben, arbeiten. Jede dieser Geschichten gewährt also Einblick in ein Leben. In Summe erzählen sie aber auch von der Möglichkeiten des Zusammenlebens, vom aktuellen Stand des gesellschaftlichen Zusammenhalts, natürlich auch von Schwachstellen, die schnell zu Bruchstellen werden können.
„Ich will so lange leben, bis ich sterbe.“
Ein Vorwort von Ludwig Laher
Zeit meines Autorenlebens empfand ich es als wesentlich spannender, Geschichten auf der Straße aufzulesen, anstatt sie zu erfinden. Hinter meinen Gegenwartsromanen stehen, um fiktionale Elemente ergänzt, echte Menschen aus Fleisch und Blut, mit denen ich je mehrmals lange, intensive Gespräche führen durfte. Mit manchen davon habe ich noch heute Kontakt.
Voraussetzung für solche Unterfangen ist eine grundsätzliche Lust aufs Zuhören. Es geht darum, Gesprächspartnern das Gefühl zu geben, worüber sie zu berichten haben, sei wichtig, zumindest allemal wert, in Worte gekleidet zu werden. Ich verdiente mir meine Sporen in den 1980ern, als ich für Ö1 sorgfältig gearbeitete Hörbilder gestaltete. Sorgfältig gearbeitet, das heißt möglichst wenig verbindender Text, stattdessen eine Komposition aus O‑Tönen, die eine Geschichte entwickeln, weitertreiben, darüber reflektieren, andere Sichtweisen anbieten, ein- ander zuweilen dementieren. Natürlich, der Komponist war ich, ich gab dem Ganzen ein Gesicht, eine Richtung. Aber da war viel Platz für ungefilterte Äußerungen, auch für solche, die dem Gestalter der Sendung gegen den Strich gingen.
Um und Auf für ein Gelingen der jeweiligen Produktion war die Zurückhaltung dessen, der etwas erfahren will. Ziel war es, Menschen zu motivieren, möglichst ohne meine Zwischenfra- gen oder Einwürfe Erlebtes zu schildern, Meinungen zu vertreten, Gedanken zu entwickeln, sich klar werden zu dürfen. Deswegen war es mir darum zu tun, mein Interesse, mein Wissen- wollen lediglich durch unaufdringliche, gleichwohl aktive Präsenz zu vermitteln, durch Blicke etwa, durch Kopfnicken, durch Zeitnehmen für die Sache.
Die meisten sind es nicht gewohnt, einem fremden Gegenüber über ihr Leben, ihre Pro- bleme, ihre Freuden, ihre Liebhabereien oder ihre Haltungen wirklich Bescheid zu geben. Dass das auf den folgenden Seiten so häufig und teilweise so intensiv, so intim geschieht, spricht einerseits für das methodische Geschick der für das Projekt Verantwortlichen, andererseits für den großen Bedarf. „Es tut gut, sich von der Seele zu reden, was einen belastet“, heißt es wörtlich am Ende der detaillierten Schilderung einer konfliktträchtigen Mutterbeziehung. Ein Buch wie das vorliegende hat einen ganz anderen Charakter als die typische Kommunikation unter Facebook-‚Freundinnen und ‑freunden‘ oder in den meisten anderen mehr oder weniger sozialen Internetforen.
Junge Leute treten hier, weitgehend anonym zwar, vor ein Lesepublikum und dürfen monologisieren. Niemand will etwas Bestimmtes hören, niemand unterbricht sie, fordert eine bestimmte Wörteranzahl, die – wie es im Schulleben üblich geworden ist – bei Unter- oder Überschreiten Abzüge in der Notenfindung zur Folge hat, weil das Wie, die Fertigkeit, die Kompetenz, Vorgaben zu entsprechen, mehr zählt als das Was, der Inhalt. Die einen haben kaum etwas zu sagen, andere wollen so gut wie nichts preisgeben, wieder andere sprudeln nur so und scheuen sich auch nicht davor, äußerst Unangenehmes an- und auszusprechen: Flucht vor dem Krieg und vor der Gesetzlosigkeit in gescheiterten Staaten, Gewaltexzesse in der Familie, Alkoholismus und Spielsucht der Eltern, Scheidungen, Erkrankungen und Todesfälle, Drogen, Kleinkriminalität, Mobbing sowie chronisch gewordene psychische Probleme bis hin zu Suizidversuchen samt ihren möglichen Ursachen. Von derlei Tiefschlägen Verschonte beto- nen dagegen nicht selten, wie glücklich sie sind, von Dankbarkeit ist immer wieder die Rede und von erwiderter Zuneigung, in der Familie, in Partnerschaften, durch das Lieblingstier. Sehnsucht steht neben Zufriedenheit, Aggression neben Gelassenheit, Arroganz neben Bescheidenheit, Glück neben Elend.
Die einen fühlen sich beheimatet, geerdet, die anderen wild hin- und hergeworfen. Es ist wenig verwunderlich, dass besonders Jugendliche mit Migrationshintergrund oft nicht recht wissen, wo sie dazugehören, dazugehören wollen, sollen. Bei jenen erstaunlich vielen, die ernsthaft erwägen, später in das Land ihrer Eltern, ihrer Vorfahren überzuwechseln, lassen sich die unterschiedlichsten Gründe dafür zumindest durchspüren: Verwurzeltsein in kulturel- len Traditionen, die hierzulande wenig Anklang jenseits bestimmter Communitys finden, per- sönlich empfundene Ablehnung durch die österreichische Mehrheitsgesellschaft, ein in den letzten Jahren verstärkt populär gewordener Nationalismus als scheinbar identitätsförderndes Lebenselixier sind nur einige davon.
Etlichen (naturgemäß männlichen) Jugendlichen fließt das Testosteron nur so aus der Feder, das Streben nach platzhirschartiger Präsenz. Andere stellen sich selbst in den Schat- ten, werden kaum greifbar, bleiben blass. Manche wirken, meist schrecklichen Lebensschick- salen geschuldet, weit älter als die Zahl ihrer Jahresringe. Das bunte, aufschlussreiche Textkaleidoskop lehrt uns in jedem Fall überzeugend, dass Fortuna ihr Füllhorn alles andere als gleichmäßig über die Kinder dieses Planeten ausgießt.
Apropos lehren: Die Buchreihe WIR. BERICHTE AUS DEM NEUEN OE dreht den gängigen Lehrspieß um. Jugendliche, gewöhnlich als Auskunftspersonen, als Themensetzer wenig gefragt, lassen alle, die sich auf ihre Texte einlassen, ganz ohne ausgefahrenen Zeigefinger in die Lehre gehen. Zumindest mittelbar werden Leserinnen und Leser mit den immensen Herausfor- derungen konfrontiert, denen sich diese Generation gegenübergestellt sieht, ohne viel Chance auf echte Partizipation und verbesserte Rahmenbedingungen für ihre Existenz.
Oft heißt es, Solidarität und gemeinschaftliches Wollen spielten bei den Kids heutzutage eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Natürlich kämpfen nicht wenige für sich allein, sehen die anderen vornehmlich als Konkurrenz, als Bedrohung: „Ich habe nie jemanden gebraucht, der mir weiterhelfen muss, denn ich weiß, dass fast keine Freundschaft echt ist und dass fast alles eine Lüge ist. Ich weiß jetzt, wie man sich Problemen stellt. Ich weiß, wie man aus dem Dreck rauskommt oder wie man etwas kriegt, was man möchte.“ Aber die Aussa- gen der meisten stehen eindeutig gegen die Ellbogengesellschaft und honorieren Zuwendung, Hilfe, bloßes Dasein für andere häufig mit berührenden Worten. Gesellschaftliche Defizite wer- den durchaus erkannt, machen nicht selten Angst, nur kann sich kaum ein junger Mensch jen- seits des allerprivatesten Umfelds vorstellen, für gemeinschaftliche Interessen einzutreten.
Viele sind sich der Ursachen für das, was ihnen abgeht, wehtut, womit sie zu kämpfen haben, vollkommen bewusst. Vor ihren Analysen, ihrer Reife, ihren Versuchen, etwa Elterntei- len, von denen sie sich alleingelassen oder schlecht behandelt fühlen, trotz allem Gerechtig- keit widerfahren zu lassen, kann man nur den Hut ziehen. Und doch scheinen ihnen Auswege verbaut, scheinen Bezugspersonen unwillens oder außerstande mitzuhelfen, den verfahrenen Karren miteinander aus dem Dreck zu ziehen. Manchmal würde es wohl ausreichen, erfahrene Mediatoren beizustellen.
Nur ganz wenige sind bewusst darauf aus, sich vor der Öffentlichkeit als Widerlinge zu inszenieren, aber auch fishing for compliments, bewusstes Sympathieheischen kommt kaum vor. Genau das macht die große Mehrheit der Beiträgerinnen und Beiträger so sympathisch.
Erstaunlich, dass manche sich der elementaren Widersprüche ihrer eigenen Argumenta- tion gar nicht bewusst sind: „Ich hoffe, dass die Menschen es endlich kapieren, wie sie mit ihrer Umwelt umgehen sollten. Schließlich ist es unsere Zukunft und unsere Erde, die die heu- tige Jugend bewohnen soll. Außerdem kann ich dann kein Haus bauen, wenn alles zugebaut ist.“ An dieser Stelle etwa wäre anzusetzen, nicht in diesem Buch, dessen große Leistung in der nahezu kommentarlosen Präsentation der Beiträge besteht, sondern im wirklichen Leben, zuvorderst in der Schule, der freilich dermaßen viel aufgebürdet wird, dass die Lehrerinnen und Lehrer für zentrale Bereiche wie das soziale Lernen kaum Zeit aufwenden können.
Junge Leute ernst zu nehmen bedeutet in einem ersten Schritt, ihnen ohne Einschränkung die Möglichkeit einzuräumen, frisch von der Leber weg über alles zu reden, was ihnen auf dem Herzen liegt. Dann aber ginge es in vielen Fällen darum, aufgeworfene Themen, (Vor-)Urteile und Widersprüche in einen produktiven Prozess der Auseinandersetzung überzuführen, und sei es zunächst nur, indem man nachfragt.
Du möchtest dir ein eigenes Haus bauen und fürchtest, es nicht zu können, weil die ande- ren mit der Umwelt, unserer Erde rücksichtslos umgehen und alles zugebaut haben werden, bis du an der Reihe bist? Was für eine Logik steckt da dahinter? Sollst du dürfen, was du anderen zum Vorwurf machst? Warum eigentlich?
Du möchtest zum türkischen Militär, weil du für dein Land kämpfen willst? Dazu braucht man aber einen Krieg oder Ähnliches. Bist du also aufs Kriegführen aus und wenn ja, wieso?
Du schreibst unvermittelt und scheinbar zusammenhanglos den Satz: Alle hassen den Ver- räter, doch lieben den Verrat. Was willst du uns damit eigentlich sagen?
Eine ganze Reihe von Burschen und Mädchen stellt selbst die entscheidenden Fragen, auch solche, die ans Eingemachte gehen. Derlei darf man wohl als ein Angebot zum Dialog bis hin zum Hilfeschrei in extremen Fällen verstehen: Bin ich anders? Wie schaut denn so ein „Ausländer“ aus? Warum wurde ich zur Außenseiterin? Wieso muss man sich denn immer überall anpassen? Wie soll man sich einer schwer Depressiven gegenüber verhalten?
Wenn ich das Gefühl habe, eine große Prosa ist mir gelungen, ist das schön. Noch schö- ner allerdings ist es, wenn die echten Menschen, die hinter meinen Romancharakteren stehen, durch die gemeinsam verbrachte Zeit und das Eintauchen in ihre Geschichte, durch mein Nachfragen und ihr eigenes Weiterspinnen hinterher einen Schritt weiter sind. Und was ich selbst alles aus diesen Begegnungen verstehen gelernt habe, lässt sich nicht annähernd in Worte fassen. Zuweilen gelingt es mit vereinten Kräften sogar, im wirklichen Leben bedrückende Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
Als gelungen kann ich ein Romanvorhaben dann empfinden, wenn ich es schaffe, eine Story so zu erzählen, dass sie ganz nah an einzelnen Menschen bleibt und gleichzeitig doch die gesellschaftliche Verfasstheit, die Strukturen, in die wir, ob wir wollen oder nicht, einge- bettet sind, zum Thema macht. Und das möglichst unaufdringlich.
Bücher wie dieses leisten dasselbe. Sie sind mehr als die bloße Summe ihrer einzelnen Bestandteile. Ihnen lassen sich aufschlussreiche Befunde über die Verfasstheit dieses Öster- reich, dieses Salzburg entnehmen, und zwar aus dem Blickwinkel derer, die bald einmal das Ruder übernehmen werden (müssen). Am eindringlichsten ist für mich die Erkenntnis, dass alle reaktionären Versuche, Menschen wegen ihrer Herkunft oder Religion erneut von vorn- herein in gute und schlechte einzuteilen, in die unsrigen und die fremden, Diskriminierung zu schüren, wo es nur geht, und Zwietracht in die Köpfe einzupflanzen, nach gründlicher Lektüre dieses Buches diskreditiert, überzeugend enttarnt sind. Enttarnt als böswillige Verkennung des Umstandes, dass wir es in erster Linie mit grundsätzlich ähnlich gestrickten Menschen zu tun haben, ganz gleich, ob sie türkische, vietnamesische oder Tiroler Wurzeln haben, ganz gleich, welchen Gott sie anbeten oder überwunden haben. Überall gibt es, no na, Schlitzoh- ren, Durchschnittszeitgenossen und wunderbare Menschen. Hören wir hin, hören wir zu.
In diesem Buch steht ein Satz, den ich sofort notieren musste. Aus dem Kontext erschließt sich, dass er wahrscheinlich gar nicht so gemeint war, wie ich ihn verstehen wollte. Im Gegenteil: Die Fünfzehnjährige, die ihn zu Papier brachte, ist desillusioniert von den widri- gen Umständen, unter denen sie aufwachsen muss. Künstlerin würde sie gerne werden, aber die Mutter besteht darauf, dass sie Friseurin wird. Ihre Brüder sind den Eltern gegenüber respektlos und der Schwester gegenüber ignorant, arbeiten nicht, trotzdem zählen sie für die Mutter weit mehr als die Tochter. Der Vater ist spielsüchtig, betrügt seine Frau. „Ich will eigentlich nur Geld verdienen und so lange leben, bis ich sterbe. Ich hab auch keine Freunde, weil ich sehr verschlossen bin, und eigentlich habe ich nie jemandem so viel anvertraut, wie ich hier geschrieben habe.“
Ich sehe Leserinnen und Leser schmunzeln und der jungen Frau auf die Schulter klopfen: Keine Bange, dein Wunsch, bis zu deinem Tod zu leben, wird garantiert in Erfüllung gehen. Aber nicht nur die Summe kann mehr sein als die einzelnen Teile, auch ein Text kann klüger, vielschichtiger sein, als seine Urheberin es beabsichtigte. Mir vermittelt er nämlich, dass das gewesene Kind leben möchte, bis es stirbt. Leben und nicht vegetieren.
Dr. Ludwig Laher ist Schriftsteller und lebt in St. Pantaleon im Grenzgebiet Bayern/Salzburg/Oberösterreich sowie in Wien.